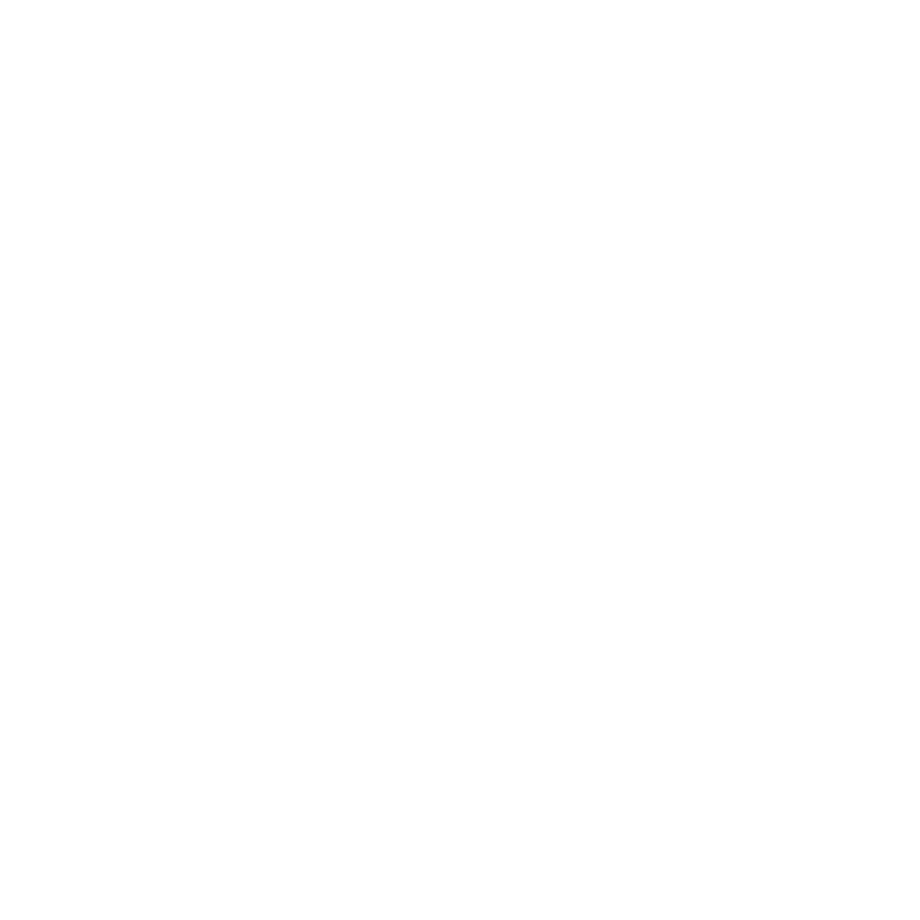
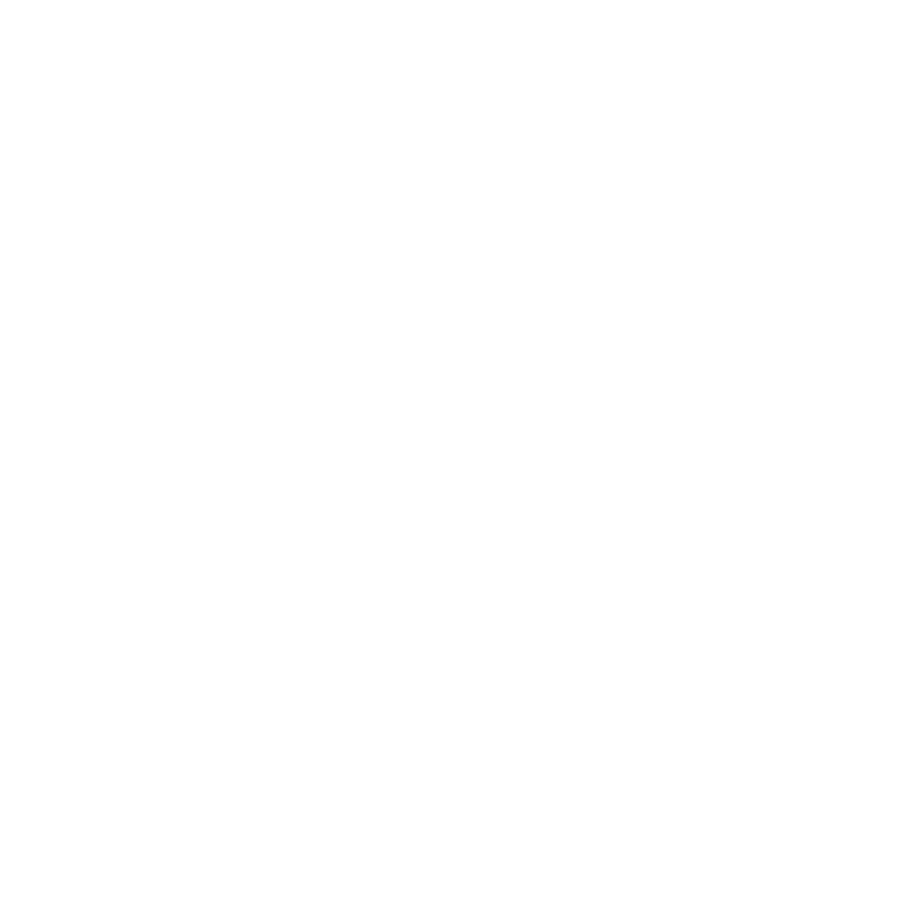
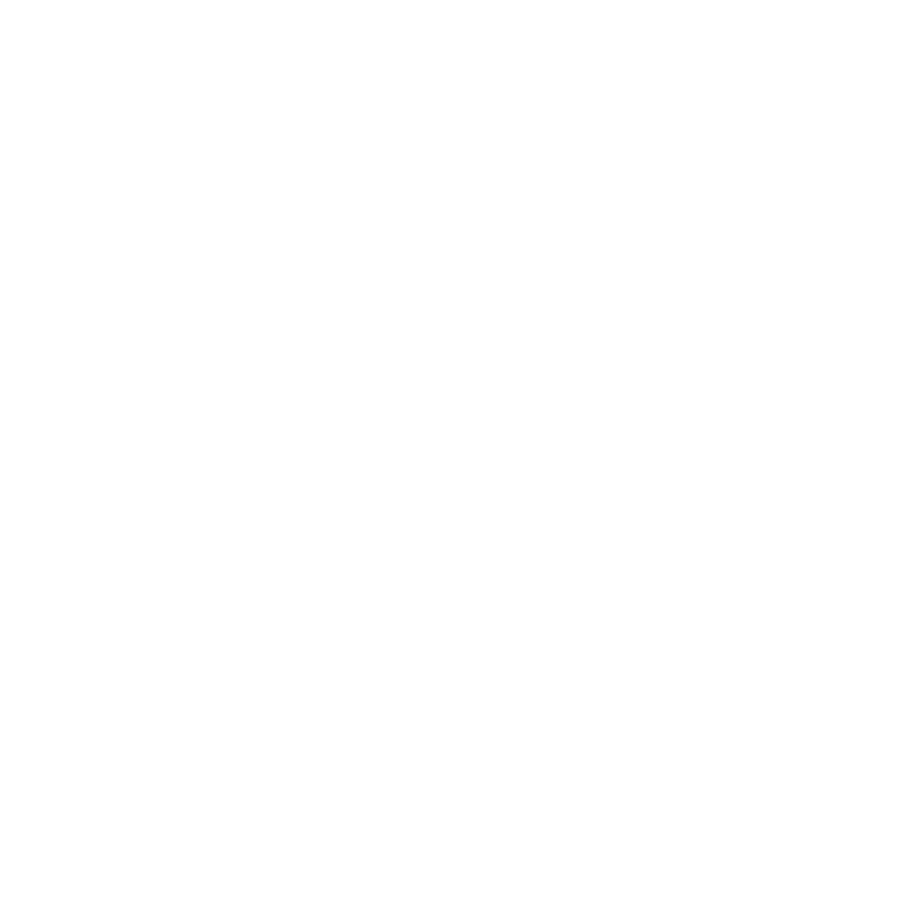
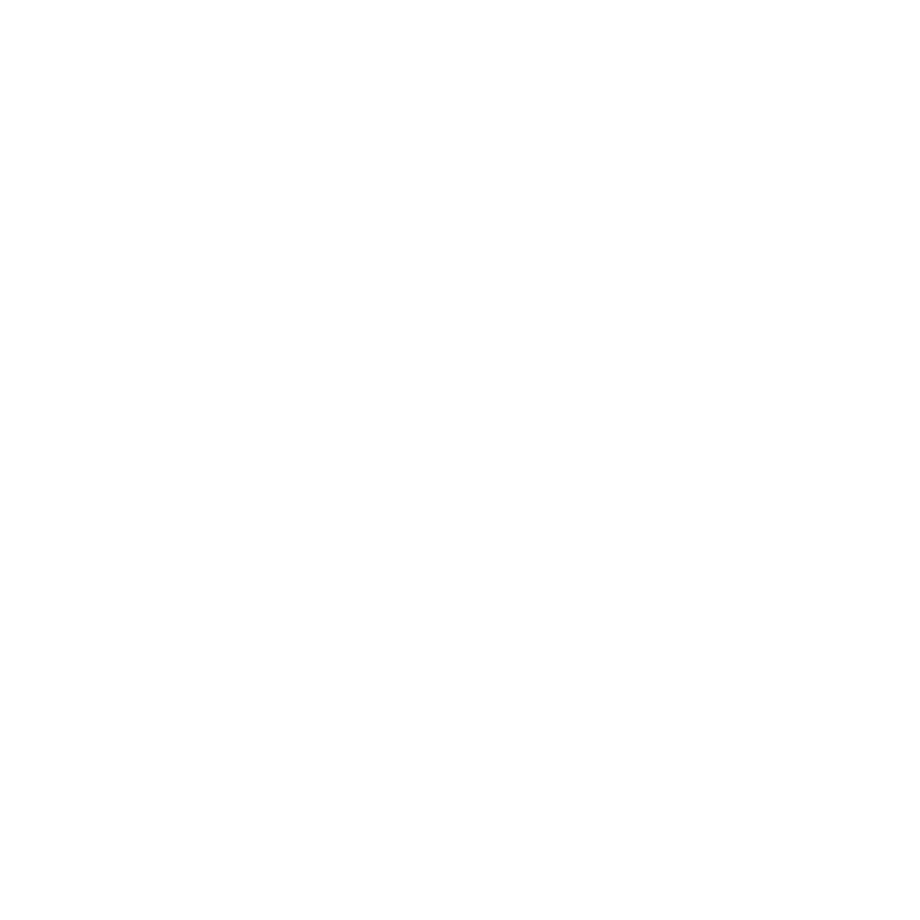
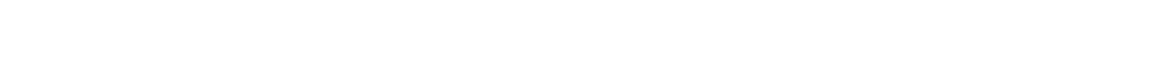
Datenschutzerklärung, Stand: 25. Mai 2018
Der Schutz Ihrer Privatsphäre bei der Nutzung des Webangebots des Instituts für Bank- und Finanzgeschichte e.V., Frankfurt am Main auf den Seiten www.ibf-frankfurt.de ist uns wichtig. Wir bitten Sie daher, die nachstehenden Informationen zur Kenntnis zu nehmen.
Grundsätzlich ist ein Besuch der Webseiten des Instituts für Bank- und Finanzgeschichte e.V., Frankfurt am Main möglich, ohne dass Sie uns mitteilen, wer Sie sind. Zu statistischen Zwecken erhalten wir lediglich Kenntnis über den Namen Ihres Internetservice-Providers, während Sie selber als Nutzer anonym bleiben. Das Institut für Bank- und Finanzgeschichte e.V., Frankfurt am Main verwendet die hierbei erhobenen Daten lediglich, um Informationen zur Nutzung des Webangebots auf www.ibf-frankfurt.de zu erhalten und um den Inhalt der Seiten und die darin enthaltenen Serviceangebote fortlaufend zu verbessern. Zur Gewährleistung der Datensicherheit speichert das Institut für Bank- und Finanzgeschichte e.V., Frankfurt am Main die erhobenen Daten auch auf Backupmedien. Über die bei einem Aufruf unserer Seiten erhobenen Daten möchten wir Sie im Folgenden informieren:
Cookies
Die Internetseiten des Instituts für Bank- und Finanzgeschichte e.V., Frankfurt am Main verwenden teilweise so genannte Cookies. Dies richten auf Ihrem Rechner keinen Schaden an und enthalten keine Viren. Sie dienen vielmehr dazu, unser Angebot nutzerfreundlicher, effektiver und sicherer zu machen. Cookies sind kleine Textdateien, die auf Ihrem Rechner abgelegt werden und die Ihr Browser speichert.
Bei den meisten der von uns verwendeten Cookies handelt es sich um „Session-Cookies“, die nach Ende Ihres Besuchs automatisch gelöscht werden. Andere Cookies bleiben auf Ihrem Endgerät gespeichert, bis Sie diese löschen. Diese Cookies ermöglichen es uns, Ihren Browser beim nächsten Besuch wiederzuerkennen. Sie können Ihren Browser so einstellen, dass Sie über das Setzen von Cookies informiert werden. Sie können über Ihre Browsereinstellung des Weiteren Cookies nur im Einzelfall erlauben, die Annahme von Cookies für bestimmte Fälle oder generell ausschließen sowie das automatische Löschen der Cookies beim Schließen des Browsers aktivieren. Wenn Sie sich entscheiden, Cookies zu deaktivieren, kann die Funktionalität der Webseiten des Instituts für Bank- und Finanzgeschichte e.V., Frankfurt am Main eingeschränkt sein.
Server-Log-Files
Der Provider unserer Webseiten erhebt und speichert automatisch Informationen in so genannten Server-Log Files, die Ihr Browser automatisch an uns übermittelt. Diese Informationen umfassen im Einzelnen Angaben
Diese Daten können nicht einzelnen Besuchern unserer Webseiten zugeordnet werden. Eine Zusammenführung dieser Daten mit anderen Datenquellen wird nicht vorgenommen. Wir behalten uns vor, diese Daten nachträglich zu prüfen, wenn uns konkrete Anhaltspunkte für eine rechtswidrige Nutzung bekannt werden.
E-Mails und Kontaktformular
Soweit Sie uns eine E-Mail senden oder über das Kontaktformular auf unseren Webseiten mit uns in Verbindung treten, werden diese Daten ebenfalls zum Zwecke der Bearbeitung gespeichert. Diese Daten unterliegen in jedem Fall dem Datenschutz. Eine Weitergabe der aufgrund der Nutzung dieses Internetangebots anfallenden Daten an Dritte erfolgt in keinem Fall, es sei denn, wir wären hierzu gesetzlich verpflichtet. Grundsätzlich nutzen wir die hierbei anfallenden Daten nur in dem hierzu erforderlichen Umfang zur Bearbeitung Ihrer Anfragen und Aufträge.
Verwendung von Google Maps
Diese Website benutzt Google Maps zur Darstellung eines Lageplanes. Google Maps wird von Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA betrieben. Durch die Nutzung unserer Webseiten erklären Sie sich mit der Erfassung, Bearbeitung und Nutzung der automatisch erhobenen sowie der von Ihnen eingegeben Daten durch Google, einer seiner Vertreter, oder Drittanbieter einverstanden. Die Nutzungsbedingungen für Google Maps finden Sie unter http://www.google.com/intl/de_de/help/terms_maps.html). Ausführliche Details finden Sie im Datenschutz-Center von google.de: Datenschutzbestimmungen (https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de).
Newsletterdaten
Wenn Sie den Newsletter des Instituts für Bank- und Finanzgeschichte beziehen möchten, benötigen wir von Ihnen eine E-Mail-Adresse sowie Informationen, die uns die Überprüfung gestatten, dass Sie der Inhaber der angegebenen E-Mail-Adresse sind und mit dem Empfang des Newsletters einverstanden sind. Weitere Daten werden nicht erhoben. Diese Daten verwenden wir ausschließlich für den Versand der angeforderten Informationen und geben sie nicht an Dritte weiter. Die erteilte Einwilligung zur Speicherung der Daten, der E-Mail-Adresse sowie deren Nutzung zum Versand des Newsletters können Sie jederzeit widerrufen, zum Beispiel über den "Austragen"-Link im Newsletter.
SSL-Verschlüsselung
Diese Seite nutzt aus Gründen der Sicherheit und zum Schutz der Übertragung vertraulicher Inhalte, wie zum Beispiel der Anfragen, die Sie an uns als Seitenbetreiber senden, eine SSL-Verschlüsselung. Eine verschlüsselte Verbindung erkennen Sie daran, dass die Adresszeile des Browsers von "http://" auf "https://" wechselt und an dem Schloss-Symbol in Ihrer Browserzeile. Wenn die SSL Verschlüsselung aktiviert ist, können die Daten, die Sie an uns übermitteln, nicht von Dritten mitgelesen werden.
Recht auf Auskunft, Löschung, Sperrung
Wir speichern Daten so lange, wie Sie Informationen und Einladungen zu Veranstaltungen erhalten oder wir mit Ihnen in Kontakt bleiben möchten. Sie können Auskunft über ihre bei uns gespeicherten persönlichen Daten verlangen und haben ein Recht darauf, eine Kopie Ihrer Daten zu erhalten. Zudem können Sie in berechtigten Fällen die Löschung oder Berichtigung Ihrer Daten verlangen. Ihre Einwilligung zum Erhalt von E-Mail-Informationen durch das Institut für Bank- und Finanzgeschichte e.V., Frankfurt am Main können Sie jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Sie können der Verarbeitung Ihrer Daten zur Ankündigung von Veranstaltungen des Instituts für Bank- und Finanzgeschichte e.V., Frankfurt am Main jederzeit widersprechen. Zur Ausübung dieser Rechte können Sie sich beispielsweise in der Antwortfunktion auf eine unserer E-Mails mit Betreff "Abbestellung Newsletter/Einladungen" an uns wenden. Ergänzend können Sie sich an die Berliner Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit als zuständige Aufsichtsbehörde wenden. Gerne stehen wir Ihnen aber auch unter den auf unseren Webseiten genannten Kontaktdaten zur Verfügung.
Recht auf Auskunft, Löschung, Sperrung
Wir speichern Daten so lange, wie Sie Informationen und Einladungen zu Veranstaltungen erhalten oder wir mit Ihnen in Kontakt bleiben möchten. Sie können Auskunft über ihre bei uns gespeicherten persönlichen Daten verlangen und haben ein Recht darauf, eine Kopie Ihrer Daten zu erhalten. Zudem können Sie in berechtigten Fällen die Löschung oder Berichtigung Ihrer Daten verlangen. Ihre Einwilligung zum Erhalt von E-Mail-Informationen durch das Institut für Bank- und Finanzgeschichte e.V., Frankfurt am Main können Sie jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Sie können der Verarbeitung Ihrer Daten zur Ankündigung von Veranstaltungen des Instituts für Bank- und Finanzgeschichte e.V., Frankfurt am Main jederzeit widersprechen. Zur Ausübung dieser Rechte können Sie sich beispielsweise in der Antwortfunktion auf eine unserer E-Mails mit Betreff "Abbestellung Newsletter/Einladungen" an uns wenden. Ergänzend können Sie sich an die Berliner Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit als zuständige Aufsichtsbehörde wenden. Gerne stehen wir Ihnen aber auch unter den auf unseren Webseiten genannten Kontaktdaten zur Verfügung.
Datenerfassung bei Online-Anmeldungen zu Veranstaltungen
Wenn Sie an einer Veranstaltung des Instituts für Bank- und Finanzgeschichte e.V. (IBF) teilnehmen, erarbeiten wir folgende personenbezogenen Daten:
Wir verarbeiten die personenbezogenen Daten, mit denen Sie sich für eine Veranstaltung (z.B. Vortrags- oder Diskussionsveranstaltung, Workshop, Buchvorstellung, Symposium, Kolloquium, etc.) anmelden (Anmeldedaten). Neben Ihrem Namen zählen hierzu ggf. die Institution, in der Sie arbeiten, Ihre E-Mail-Adresse, Ihre Anschrift etc.
Ihre im Rahmen einer Veranstaltung des IBF erhobenen Daten werden ausschließlich im Zusammenhang mit Ihrer Anmeldung und Teilnahme an dieser Veranstaltung verarbeitet. Die Datenverarbeitung dient zum einen der Veranstaltungsorganisation, beispielsweise der Verwaltung von Zu- und Absagen, der Erstellung von Namensschildern, der Erreichbarkeit der Teilnehmer und Teilnehmerinnen und der Anpassung der Veranstaltungsmodalitäten (z.B. Raumgröße, Verpflegungsmanagement, etc.). Zum anderen wird aus den Daten ggf. eine Teilnehmerliste erstellt, die auch den mit der Einlasskontrolle beauftragten Personen übermittelt wird.
Ihre Daten werden ggf. an mögliche Mitveranstalter übermittelt, die sie ebenfalls zur Veranstaltungsorganisation nutzen. Eine sonstige Weitergabe Ihrer personenbezogenen Daten an Dritte, insbesondere zu kommerziellen Zwecken, findet nicht statt.
Rechtsgrundlage der Verarbeitung Ihrer Anmeldedaten ist Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Ihre personenbezogenen Daten werden gelöscht, sobald sie für die Erreichung des angegebenen Zweckes nicht mehr erforderlich sind. Dies ist grundsätzlich mit Beendigung der Veranstaltung der Fall. Bei kostenpflichtigen Veranstaltungen ergibt sich die Speicherdauer aus den gesetzlichen Aufbewahrungsfristen.
Eine Ausnahme besteht, wenn Sie der Nutzung Ihrer Daten für unseren Newsletter zugestimmt haben/zustimmen. In diesem Fall werden Ihre Daten bis zu ihrem Widerruf zur Versendung unserer Newsletter gespeichert (s. Punkt „Newsletterdaten“ in unserer allgemeinen Datenschutzerklärung) und das Anmeldeformular entsprechend vorausgefüllt.